Klassiker9 min Lesezeit
Der Verkehrtherumsegler
Die Geschichte des 18 m Dreimasters von Hans-Joachim Kulenkampff

Wie es zur eigenwilligen Takelage der Yacht des Showmasters und begeisterten Seglers Hans-Joachim Kulenkampff kam. Besichtigung des liebevoll generalüberholten Schiffes mit Probeschlag bei frischem Wind auf der Weser.
Von Erdmann Braschos
Das erwartet Sie in diesem Artikel
- Einzelheiten zur „Langlütjen“, ex. "Kadija", ex. „Marius IV.“
- die Takelage mit mehreren Stagsegeln
- Rumpfform einer echten Blauwasseryacht
- wie Kulenkampff zu diesem Boot gelangte
- was aus der Yacht des 1998 verstorbenen Showmasters wurde
- das Refit und Beobachtungen beim Probeschlag
Was stellen Männer in den besten Jahren an, wenn plötzlich der Geldregen einsetzt? Sie machen mit einem flachen Sportwagen und ähnlich flüchtigen Geschichten Blödsinn. Den liess der Schauspieler und Showmaster Hans-Joachim Kulenkampff aus, als er für die Tabakreklame „Feuer, Pfeife, Stanwell“ in den Siebzigerjahren ein Vermögen bekam. Er steckte die stattliche Summe von 650 000 Mark in eine Sonderanfertigung ganz nach seinem Gusto. Dafür kauften Vernunftmenschen damals einen Schwung Immobilien zur Vermietung oder ein Haus in ausgezeichneter Lage. Nun sind Immobilien bekanntlich eine feine Sache. Sie steigen im Wert, verdienen Geld und so weiter. Leider sind sie nicht halb so interessant wie ein Boot. So liess der Genussmensch Kulenkampff Anfang der Siebzigerjahre bei der angesehenen Fassmer Werft an der Weser sein Traumschiff aus unkaputtbarem Aluminium schweissen. Dieser Spezialist ist heute noch für Rettungsboote und Spezialschiffe bekannt.
Zwar wurde das Schiff deutlich teurer als gedacht, doch trübte das seinen Stolz und seine Freude am Ergebnis kaum. Kulenkampff war so zufrieden mit dem Boot, dass er sich mit einem Brief an die Werft bedankte.

Der 53-Jährige hatte einen über Deck 15,50 Meter langen Stagsegelschoner von Horst Glacer entwerfen lassen, 18 Tonnen schwer. Das stäbige Schiff mit V-förmigem Übergang vom Rumpf zum Kiel war ideal für die ruppigen Verhältnisse der Wesermündung oder wo immer es auf der Nord- und Ostsee übel zugeht. Die Werft hatte das Schiff untenherum aus 10 bis 8 mm dickem Aluminiumblech gewissermassen in Eisklasse geschweisst.
Kulenkampff hätte mit dem Schlitten ohne Weiteres nach Grönland oder zu den Fidschi-Inseln ablegen können. Nun war Kulenkampff aber ein viel beschäftigter Mann, weshalb sein Lieblingstörnziel mit der Insel Anholt in erreichbarer Ferne mitten im Kattegat lag.
Um zu verstehen, wie es zur aufwendigen Takelage auf dieser Bootslänge kam, muss man wissen, dass rollbare Segel zum komfortablen Segelhandling seinerzeit noch nicht erfunden waren. Auch die selbstholende Winsch gab es nicht. So bekam das Boot anstelle der üblichen ein- oder zweimastigen Takelage mit unhandlich grossen Tüchern sage und schreibe drei Masten. Vor denen wurden handliche Stagsegel und achtern ein Besan gesetzt.

Die Blaupause dazu war die 39 Meter lange „Vendredi 13“. Sie war anlässlich der 1972er-Einhand-Atlantik-Regatta von England nach Amerika entstanden. Diese Segelmaschine sollte den Kurs von Ost nach West auf dem gnadenlos gesegelten Am-Wind-Kurs bei viel Wind mit der effizienten wie variablen Besegelung und ihrer enormen Länge entscheiden.
So wurde auch an Bord der „Marius IV.“ bei auffrischendem Wind eines der handlichen Stagsegel geborgen. 23 bis 30 Quadratmeter lassen sich an Stagreitern flatternd immer wegpacken. Das bekamen Kuli und sein Matrose Meyer auch in der schietigsten Böe problemlos hin.

Der ungewöhnliche Look brachte dem Boot bald den Spitznamen „Verkehrtherumsegler“ ein. Denn die eigenartige Geometrie vermittelte auf den ersten Blick den Eindruck, da stimme etwas nicht und das Boot würde rückwärts segeln. Wenn dieser Bonsai-Dreimaster einer Fata Morgana gleich vor der Wesermündung auf der Nordsee erschien, wussten die Kenner an der Küste, dass das Urgestein der deutschen Fernsehunterhaltung unterwegs war. Natürlich provozierte so viel Takelage über gerade mal 15 ½ Meter Deckslänge im Hafen ständig komische Bemerkungen. Drei Masten erinnerte man vom 69 m Rennschoner „Atlantic“ oder Windjammern wie der 100 m langen Rickmer Rickmers.
So antwortete der joviale „Kuli“ irgendwann ein klein wenig müde und augenzwinkernd auf die ständig gestellte Frage, warum das Schiff denn drei Masten habe: „Weil ich vier nicht unterbringen konnte.“
Gibt es etwas Schöneres, als angesichts des eigenen Bootes zu essen?
Zum Ritual der sommerlichen Törns gehörte zunächst die Ansteuerung der Schifferklause Lehrke in Bremerhaven. Dort, an der Geeste 19, ging der Dreimaster dann längsseits. Ahnungslose Gäste, die den Fehler gemacht hatten, draussen vor dem Lokal am Tisch mit dem besten Blick auf den Hafen zu tafeln, wurden dann von der Wirtin mit dem Hinweis weg komplimentiert, sie sässen „leider gerade am Platz von Herrn Kulenkampff“. So genossen der Showmaster und sein Matrose dann an ihrem Stammplatz Speis und Trank mit Logenblick auf den Dreimaster mit kühnem Klippersteven. Gibt es etwas Schöneres, als angesichts des eigenen Bootes Scholle oder Labskaus zu essen?
Am nächsten Morgen schob sich der kühne Klippersteven der Nordsee entgegen. Die kleinen Tücher glitten an surrenden Stagreitern himmelwärts und zappelten im Westwind. Es wurde dicht geholt und Kuli stellte den Russrotzer ab. Nun begann die richtige Daseinsform, das Seglerleben in ringsum frischer Luft mit Blick zur endlosen Bläue des Meeres.
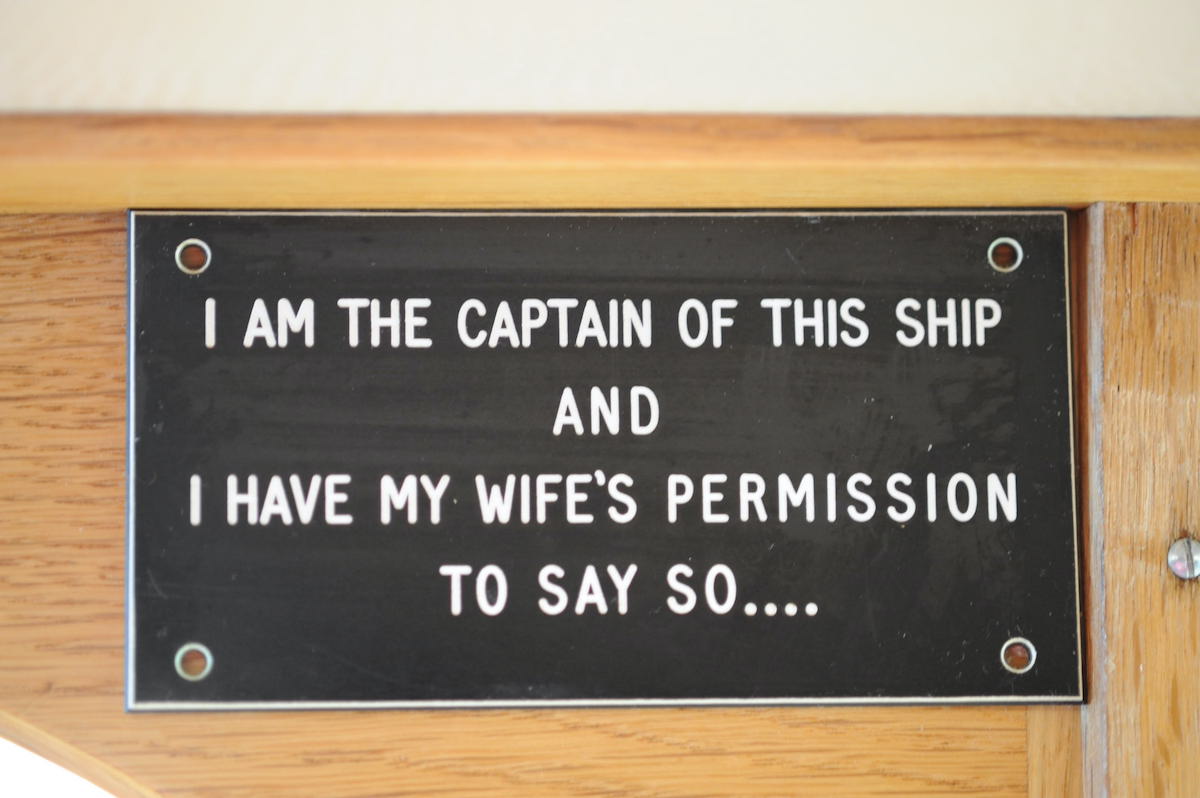
Bereits im August 1974 segelte Kulenkampff mit der soeben fertiog gestellten „Marius IV.“ nach Anholt. Angesichts des vollen Hafens ankerte er im Aussenbecken hinter den beiden halbkreisförmigen Wellenbrechern und wartete ab. So machte man das damals. „Daraufhin verschwand der eher schludrig gekleidete Hafenmeister in seinem Kontor, erschien nach einer Weile picobello in seiner Uniform gewandet und wies dem Dreimaster einen Ehrenplatz am Fähranleger an, wo sonst keine Yacht anlegen durfte“, erinnert sich der heutige Eigner Birger Winkelvoss, der als Jugendlicher zufällig mit einem anderen Boot auf der Insel war. Winkelvoss stemmt seit einigen Jahren als vierte Eigner der Yacht die Bootsbetriebsbürde.
Der Rumpf war damals weiss. Die Stagsegel wurden von drei kleinen Bäumen an Deck stabilisiert, was Kreuzkurse mit häufigen Wenden erleichterte. Das Deck war zweckmässig mit einem Belag aus Salino-förmiger Antirutschstruktur der Marke Treadmaster belegt. Nach einer Weile legte Kulenkampff das Schiff an den Steg 5 des Yachthafens Burgtiefe auf Fehmarn. Da war die Reise nach Anholt beim üblichen Westwind durch den Grossen Belt eine kommode Sache.
Kulenkampff (1921–1998) stammte aus einer Bremer Kaufmannsfamilie und wuchs in begüterten Verhältnissen auf. Segeln lernte er als Wasserpfadfinder auf der Weser. Die musische Neigung der Familie führten ihn nach seinem Debüt als Schauspieler zunächst zum Rundfunk, wo er sich als Hörfunkmoderator verdingte. Die wirtschaftlichen Voraussetzungen für „Marius IV.“ schuf er bereits 1953, als er sich anlässlich der 18. „Grossen Deutschen Rundfunk-, Phono- und Fernseh-Ausstellung“ in Düsseldorf mit seiner ersten Fernsehshow „Wer gegen wen?“ als Entertainer verdingte. Kulenkampff gewann das Publikum im damals neuen Medium mit seinem Charme und seiner Schlagfertigkeit. Zu seinen Marotten gehörte neben seinem beharrlich gepflegten Altherrenwitz das Talent, Sendezeiten unfassbar zu überziehen.
1958 und 1961 spielte Kulenkampff mit Heinz Erhardt in den Filmkomödien „Immer die Radfahrer“ und - passend zu seiner maritimen Neigung - „Drei Mann in einem Boot“. Sehr erfolgreich war er als Moderator des 43-mal Mitte bis Ende der Sechzigerjahre gesendeten Fernsehquiz „Einer wird gewinnen“, kurz EWG genannt. Wenn die ARD-Quiz-Sendung mit acht Kandidaten aus verschiedenen europäischen Ländern einmal „nur“ eine Einschaltquote von 82 Prozent hatte, drohte Kulenkampff spasseshalber: „Wenn uns die Leute nicht mehr sehen wollen, dann hören wir eben auf.“
Auch sonst war Kulenkampff mit zahlreichen Hörspielen, Theater- und Fernsehauftritten, Kinofilmen, weiteren Quizsendungen und -serien derart beschäftigt, dass man sich kaum vorstellen kann, wie er überhaupt Zeit zum Segeln fand. Als die „Marius IV.“ aufgetakelt wurde, erschien sogar ein Segellehrbuch namens „Segeln lernen mit Hans Joachim Kulenkampff“.
1991 übernahm der Berliner Immobilienkaufmann Michael Nitsch das Schiff. Kulenkampff war altershalber auf eine Motoryacht umgestiegen. 2004 kaufte dann der Bremer Jens-Torsten Bausch das Boot, segelte es eine Saison und überholte es im Lauf einiger Jahre aufwendig. Der Rumpf wurde sandgestrahlt, gespachtelt und dunkelblau lackiert. Drei Jahrzehnte nach dem Stapellauf wurde deutlich, wie sorgfältig die Fassmer Werft geschweisst hatte. Das Boot bekam ein Teakdeck, neue Masten und Stagsegel, die an Rollanlagen aus- und eingewickelt werden. Das Tuch des Besan verschwindet in einem Rollbaum.

Unter Deck ist „Langlütjen“ im Grunde die „Marius IV.“ aus Kulis Zeiten geblieben, einschliesslich schwarz-grün marmoriertem Pantry-Kacheldekor der frühen Siebzigerjahre und dem Kajütausbau in heller Eiche. Ich habe noch nie eine Zentralheizung an Bord eines Sportbootes gesehen. Bausch und sein Segelfreund, der heutige „Langlütjen“-Eigner Winkelvoss, berichten, dass sie das Boot augenblicklich, wie daheim, heizt. Die Radiatoren in eiche ähnlichem Braun fügen sich gut ins Interieur ein. Auch die Altherrensprüche, wie es sie immer noch beim Bootsausrüster gibt, hängen noch. Die Koje mittschiffs im Salon zeigt, wie praktisch das Boot ausgestattet ist.
Winkelvoss hat in den vergangen Jahren allerhand an Bord gemacht. Die starren Rohre der Zentralheizung wichen versteckt verlegten Schläuchen. Das Interieur wurde mit weissen Deckenpaneelen heller. Das Boot bekam ein Heckstrahlruder und abnehmbare Davits für ein Beiboot
Nun interessierte mich natürlich die Frage, wie sich der Bonsai-Dreimaster und Verkehrtherumsegler eigentlich steuert. Das Rad mit den gedrechselten Tropenholzspeichen hat mit etwa einem Meter Durchmesser zwar nicht ganz das Format der Pamir, erinnert dennoch an alte Zeiten. Hier stand der joviale Quizmaster mit seiner obligatorisch blauen Schiffermütze, während Matrose Schapp das eine oder andere an Deck klarierte. Erste Erkenntnis: Wenden sind mit dem nicht eben drehfreudigen Langkieler mit entschieden gelegtem Ruder energisch einzuleiten.

Angesichts von 18 Tonnen bei 100 qm Am-Wind-Besegelung und einer mageren Segeltragezahl von 3,8, einem Motorseglerwert, stellte sich die bange Frage, wie das Boot segelt. Erfreulicherweise wehte es in Böen mit bis zu fünf Windstärken. Dabei fiel mir ein erheblicher Durchhang der Stagen auf, ein Resultat der runden Masten, die unter dem Druck biegen, vermutlich auch der Art, wie die Röhren auf halber Länge verstagt sind. So limitieren die nachgiebigen Masten die Möglichkeit, mit dem Boot viel Höhe zu segeln.
Ein herrlich antiquierter Rolls-Royce zur See
Zweite Erkenntnis: Die Schotwagen rutschen nicht von selbst zum leeseitigen Anschlag, was wahrscheinlich an den Schotradien liegt, die nicht ganz zur Krümmung der Schiene passen, oder daran, dass beim Refit die Fockbäume weggelassen wurden. Das ist immer eine schwierige Sache und bei Selbstwendefocks selten ganz hinzubekommen.

Leider hat Glacer dem Boot ein spürbares bis lästiges Mass an Luvgierigkeit mitgegeben, nach dem bewährten Motto: Wer den Bug nur mit beharrlicher Arbeit am Rad aus dem Wind bekommt, mutet seinem Schiff auf Dauer weniger zu und reduziert die Segelfläche. So hat man das damals sicherheitshalber gemacht. Leider liess es sich mit gefiertem Besan kaum korrigieren, weil das Segel bald auf eines der doppelten Achterstagen drückte.
Erstaunlich fand ich, dass die „Langlütjen“ acht, gelegentlich annähernd neun Knoten Fahrt durch das glatte Wasser machte. Das Boot profitiert von viereinhalb Tonnen Blei im Kiel und der gehörigen Formstabilität dank vier Metern Breite.
Beeindruckend fand ich an diesem stäbigen Schiff den Eindruck gefühlter Sicherheit. Kulenkampffs Traumschiff fährt mit Sicherheit durch dick und Dünn. Eine richtige Blauwasser-Yacht also für lange Reisen mit kleiner Crew. Bei einer nächtlichen Bö lässt sich aus der Plicht zunächst ein, dann das zweite Vorsegel bergen, ohne dass die Freiwache aus der Koje muss. Ein Schiff, dessen Motorisierung auf die üblich frische Brise der Küste abgestimmt ist. Ein Rolls-Royce zur See, der unterstützt von einer diskret wirkenden Deckshand für die kleinen Unzulänglichkeiten des Bordlebens und die Schrullen dieses Bootes, durch die Wogen pflügt.

„Wissen Sie, irgendwie ist der Kuli bei uns immer dabei“, meinte der dritte Eigner Bausch beim Probeschlag auf der Weser über den 1998 verstorbenen Kulenkampff. „Der guckt jetzt bestimmt aus irgendeiner Wolke runter und freut sich, dass sein Schiff noch segelt.“ Darauf ein kühles Bier zur Scholle in der Schifferklause Lehrke. Und morgen dann auf mit Rauschefahrt zum Ehrenplatz nach Anholt.

Bootsdaten
- Konstruktion Horst Glacer (1934–2015)
- Bau Fassmer Werft 1973-74
- Zertifiziert vom Germanischen Lloyd, Klasse 100 A 4
- Länge über Alles (inkl. Besanbaum) 17,80 m
- Länge über Deck 15,50 m
- Länge Wasserlinie 11,60 m
- Breite 4 m
- Tiefgang 1,80 m
- Bleiballast 4,5 t
- Wandstärken des Aluminiums: Kielboden 10 mm, Kielgang 8 mm
- Motor 6 Zylinder Perkins, Range 4 M135, 89,5kW (120PS)
- Propeller 4 Blatt Variprop
- Dieseltank 450 l, Tagestank Diesel 80 l
- Wassertanks, 1 × 500, 1 × 450 l
- 16 PS Bugstrahlruder
- Besegelung insgesamt 153 qm
- drei Stagfocks, jeweils 23, 28,9 und 28 qm
- am Klüverbaum ausrollbare 55 qm Genua
- Besan (Rollbaum) mit 17,8 qm
- drei Masten, jeweils 14, 15,10 und 12,4 m über Deck

